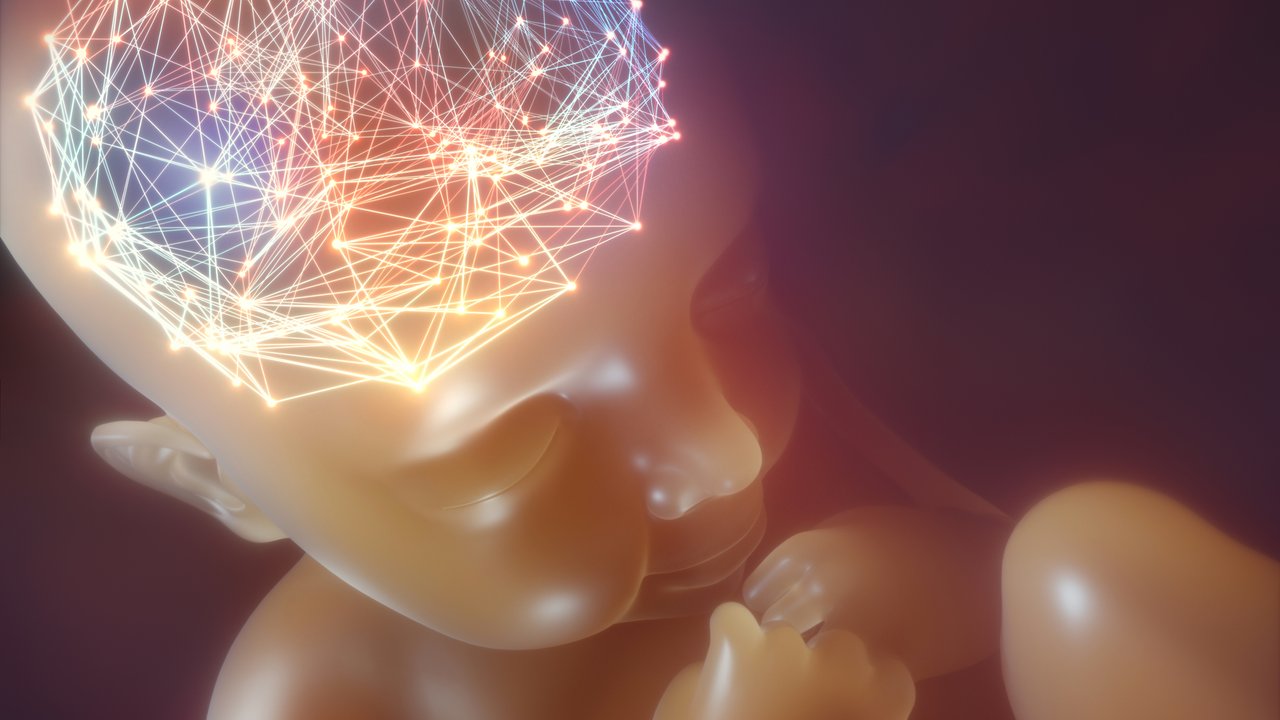Das Gehirn ist die Schaltzentrale des Körpers, hier werden alle Informationen aus der Umwelt sowie Meldungen des Organismus gebündelt und in Reaktionen verarbeitet. Der Aufbau des Gehirns ist komplex - und braucht Zeit.
Unser Gehirn ist ein fabelhaftes, hochkomplexes Organ mit enormem Leistungsvermögen. Die neun Monate "Entwicklungszeit" bis zur Geburt reichen bei weitem nicht aus, alle seine Aufgaben und Funktionen völlig auszuarbeiten. Daher sind Kopf und Gehirn diejenigen Körperteile beim Baby, die in den ersten Lebensmonaten noch am stärksten und schnellsten wachsen. Und der Babykopf ist gut darauf vorbereitet. So lange die Fontanellen noch nicht geschlossen sind, hat das Gehirn reichlich Platz zu wachsen. Das Heranwachsen und Sich-Ausbilden des menschlichen Gehirns gliedert sich in mehrere einzelne Entwicklungsstufen – und beginnt natürlich bereits im Mutterleib.
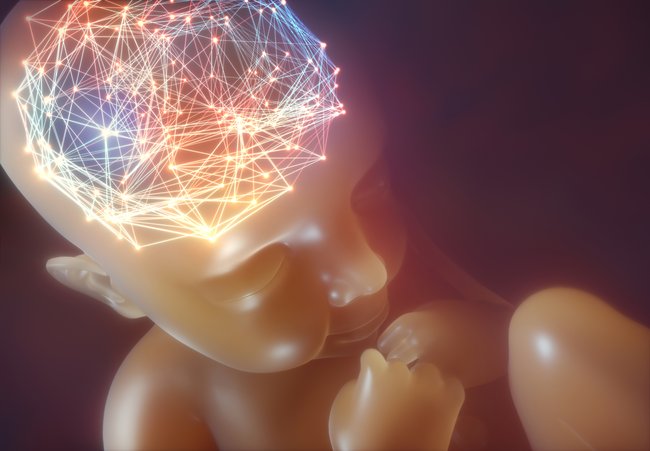
Gehirnentwicklung beim Fötus
In der dritten Schwangerschaftswoche - die Eizelle hat sich kaum eingenistet und der Embryo ist im Ultraschall noch nicht einmal als heller Schatten zu sehen - da beginnt bereits die Entwicklung von Gehirn und Nervensystem. Fünf Wochen später sind Gehirn und Rückenmark fast vollständig angelegt. Dann beginnt der Aufbau. Durch permanente Zellteilung werden in den folgenden Wochen und Monaten Unmengen von Nervenzellen gebildet. Da diese neuronalen Strukturen während der gesamten Schwangerschaft äußerst empfindlich bleiben, ist es besonders wichtig, negative Einflüsse von außen zu vermeiden. Das Nervensystem in seiner Entwicklung stören können diese Faktoren:
- Alkohol
- Rauchen
- Strahlungen
- Jodmangel
- Infektionskrankheiten der Mutter
- Medikamente
Wenn du aus gesundheitlichen Gründen auf Medikamente angewiesen bist, solltest du deren Einnahme unbedingt mit dem Arzt oder deiner Ärztin absprechen, um eventuelle negative Auswirkungen auf den Embryo zu verhindern.
Gehirnentwicklung beim Säugling
Wenn das Baby auf die Welt kommt, ist das Gehirn des Kleinen noch lange nicht fertig ausgebildet. Es wiegt auch nur ein Viertel dessen, was ein Erwachsenenhirn wiegt. Die große Mehrheit der Neuronen ist zwar schon vorhanden, es müssen sich jetzt aber die unzähligen Verbindungen zwischen den Nervenzellen bilden.
Dass das Babygehirn in den ersten Wochen und Monaten so stark an Größe und Gewicht zunimmt, kommt daher, dass ein Teil der Nervenfasern dicker wird, weil die Fasern ummantelt werden. Dadurch können sie dann Nervensignale mit hoher Geschwindigkeit weiterleiten. Dies ist wichtig, um Informationen aus der Umwelt rasch aufnehmen und mit schnellen Bewegungen auf sie reagieren zu können. In dieser Phase stehen beim Säugling zunächst in erster Linie die Reflexe im Vordergrund, um grundlegende Bedürfnisse und Empfindungen wie Hunger, Angst, Unwohlsein zu signalisieren. Nach sechs Monaten hat sich sein Gehirn dann soweit entwickelt, dass es lernt, Oberkörper und Gliedmaßen zu kontrollieren. Ein paar Monate später kommt die Steuerung der Beine hinzu, wenn das Baby zu krabbeln beginnt.
Gehirnentwicklung beim Baby
Wenn die Ummantelung der meisten Nervenfasern abgeschlossen ist und sie ihren endgültigen Umfang erreicht haben, ist das Kind etwa zwei Jahre alt. Die Nervenfasern können nun Signale mit hoher Geschwindigkeit hin und her schicken. So kann das Gehirn komplexe Bewegungen koordinieren, das Kind kann gehen, laufen und sich mit Gegenständen beschäftigen. Mit zwei Jahren haben Kleinkinder so viele Verbindungen zwischen den Nervenzellen, so genannte Synapsen, wie Erwachsene.
Gehirnentwicklung beim Kleinkind
Mit drei Jahren haben Kinder sogar doppelt so viele Synapsen wie Erwachsene, denn in den ersten drei Lebensjahren nimmt die Anzahl der Verbindungen zwischen den Nervenzellen rasant zu. In dieser Zeit entsteht das hochkomplexe Netz von Neuronen, also Nervenzellen, in dem jede Nervenzelle mit Tausenden anderer Neurone verbunden ist. Ungefähr bis das Kind zehn Jahre alt ist, bleibt diese Zahl dann konstant. Die große Anzahl der Nervenverbindungen bei Zwei- bis Zehn-Jährigen ist wichtig für die enorme Anpassungs- und Lernfähigkeit, die Kinder in diesem Alter haben. Nach dem zehnten Lebensjahr verringert sich die Zahl der Synapsen wieder um die Hälfte. Das Gehirn wird optimiert und andere Dinge treten bei der weiteren Entwicklung in den Vordergrund. Es bleiben nur noch die Nervenverbindungen erhalten, die häufig gebraucht werden; die übrigen, offenbar nicht benötigten Verbindungsstellen, werden abgebaut und verschwinden. Ab dem Jugendalter ändert sich die Zahl der Synapsen dann kaum mehr. Du siehst also: Alles, was dein Kind bis zu diesem Alter erlebt, erfahren und was es gelernt hat, beeinflusst nachhaltig die Struktur seines Gehirns.
Quelle: Neurologen und Psychiater im Netz
Bildquelle: Getty Images