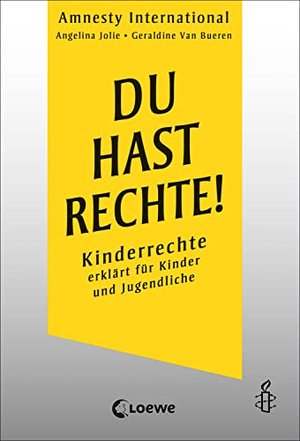“Muss ich noch …” und “Darf ich noch…” sind häufig der Beginn langer Eltern-Kind-Diskussionen. Wir klären euch allgemein und ganz praktisch über die Rechte und Pflichten eurer Kinder auf. Die aktuelle Bundesregierung hat das Thema Kinderrechte ja ebenfalls auf ihre Agenda gesetzt – worum es dabei geht.
- 1.Kinderrechte im Grundgesetz: Der aktuelle Stand
- 2.Kinderrechte: Auch kleine Menschen haben Rechte
- 3.Stehen die Kinderrechte im deutschen Grundgesetz?
- 4.Was darf mein Kind und was nicht: 9 ganz praktische Kinderrechte im Familienalltag
- 4.1.Zimmer abschließen – haben Kinder das Recht auf Privatsphäre?
- 4.2.Hat mein Kind das Recht Freunde nach Hause einzuladen?
- 4.3.Darf ich die Briefe, Emails oder Messenger-Nachrichten meines Kindes lesen?
- 4.4.Wer hat das Bestimmungsrecht über die Schlafenszeit?
- 4.5.Taschengeld – eine freiwillige oder gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung?
- 4.6.Euer Kind bekommt Taschengeld – darf es davon kaufen, was es will?
- 4.7.Ab wann dürfen Kinder allein zu Hause bleiben?
- 4.8.Hat mein Kind das Recht auf Piercings, Tattoos und Haare färben?
- 4.9.Kann mein Teenagerkind einfach ausziehen?
- 5.Kinderpflichten: Was der Staat Kindern zumutet
- 6.Welche Kinderpflichten kann ich meinem Kind zumuten?
- 7.Wie viel sollten Kinder in welchem Alter zu Hause mithelfen?
Mein Sohn ist noch klein, aber natürlich weiß er dennoch schon genau, was er will und was nicht: Seine Autos in die Kiste räumen will er lieber nicht, aber noch ein Hörspiel vor dem Schlafengehen hören unbedingt. Mit Blick auf meine Freunde mit älteren Kindern und meine Erinnerung auf meine eigene Kindheit und Jugend weiß ich, dass diese Diskussionen mit den Jahren nicht leichter werden. Deshalb ist jetzt schonmal ein guter Zeitpunkt, um sich zu informieren, welche Rechte und welche Pflichten Kinder eigentlich wirklich – also vom staatlichen Gesetz her, nicht vom elterlichen – haben.
Kinderrechte im Grundgesetz: Der aktuelle Stand
Die Bundesregierung hat sich für ihre 20. Legislaturperiode vorgenommen, Kinderrechte im Deutschen Grundgesetz zu verankern – da steht bisher nämlich nichts konkret zu Rechte für Kinder. Um das Grundgesetz dahingehend zu ändern, bedarf es jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat.
Dabei geht es übrigens nur um einen kleinen Abschnitt, um den das Grundgesetz in Artikel 6 Absatz 2 ergänzt werden soll:
"Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt."
Kinderrechte: Auch kleine Menschen haben Rechte
Wo Pflichten sind, da sind bzw. sollten auch Rechte sein. Und im Fall von unseren Kindern, gibt es klar vorgeschriebene Kinderrechte, die wir Eltern einhalten müssen. Die meisten Kinderrechte sind total logisch und werden von uns Eltern ganz natürlich eingehalten. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 verabschiedet und von den meisten Staaten (darunter auch Deutschland) ratifiziert. Aus ihr leitet sich eine universelle Verbindlichkeit der Kinderrechte ab.
Folgende vier zentrale Grundprinzipien liegen den UN-Kinderrechten zugrunde (Artikeln 2, 3, 6 und 12):
- Nichtdiskriminierung Alle Rechte gelten ausnahmslos für alle Kinder. Die Gleichbehandlung aller Menschen von Geburt an greift auch hier.
- Vorrang des Kindeswohls Bei allen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen ist das Wohlergehen des Kindes vordringlich zu berücksichtigen.
- Entwicklung Das Grundprinzip sichert das Recht jedes Kindes auf Leben, Überleben und Entwicklung.
- Berücksichtigung der Meinung des Kindes Kinder haben das Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt werden.
Darüber hinaus stehen natürlich noch viele weitere Kinderrechte in der UN-Kinderrechtskonvention, z. B. das Rechte auf Schutz der Identität, der Privatsphäre, vor Trennung von den Eltern gegen den Willen des Kindes (insofern dies nicht dem Schutz des kindlichen Wohlbefindens entgegensteht), Schutz vor Schädigung durch Medien, vor Gewaltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässigung, vor wirtschaftlicher Ausbeutung, vor Suchtstoffen, vor sexuellem Missbrauch, vor Entführung, Schutz von Kinderflüchtlingen und Minderheiten, Schutz bei bewaffneten Konflikten, Schutz in Strafverfahren und Verbot der lebenslangen Freiheitsstrafe, etc.
Stehen die Kinderrechte im deutschen Grundgesetz?
In unserem Grundgesetz sind die Kinderrechte übrigens leider noch nicht verankert. Und wie ihr an dieser Auflistung sehen könnt, fällt es der Politik scheinbar sehr schwer, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern:
- 2007 startete das Aktionsbündnis Kinderrechte – Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund, UNICEF Deutschland – die Kampagne Kinderrechte ins Grundgesetz.
- Seit Herbst 2018 hat sich eine breite Initiative bestehend aus rund 50 Organisationen der Zivilgesellschaft gegründet, um gemeinsam öffentlichkeitswirksame Aktionen vorzunehmen, die die Dringlichkeit der Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz verdeutlichen sollen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht erstmalig und eindeutig die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vor.
- Eine Bund-Länder Arbeitsgruppe arbeitete an einem Formulierungsvorschlag. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich.
- Am 8. Juni 2021 scheiterte die von der Großen Koalition vereinbarte Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Die abschließende Verhandlungsrunde mit Vertretenden der Bundestagsfraktionen blieb leider ohne Ergebnis.
- Ende 2021 verankerte die neue Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz in ihrem Koalitionsvertrag.
- Mehr Info und die Möglichkeit zur Beteiligung findet ihr auf kinderrecht.de.
Was darf mein Kind und was nicht: 9 ganz praktische Kinderrechte im Familienalltag
Die UN-Kinderrechtskonventionen sind eine super Sache und sehr wichtig. Auch die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz ist unterstützenswert. Aber wie sieht es mit ganz praktischen Kinderrechten in unserem Familienalltag aus? Was darf mein Kind und was nicht? Folgende Kinderrechte werden von Kindern zu hause häufig gefordert und mit uns Eltern diskutiert. Wer ist im Recht?
Zimmer abschließen – haben Kinder das Recht auf Privatsphäre?
Ein ganz klares JA! Alle Menschen, egal ob alt oder jung, haben ein Recht auf Privatsphäre. Das ist übrigens auch in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Ab einem gewissen Alter ist es daher durchaus legitim, wenn euer Kind seine Zimmertür lieber zu machen oder gar absperren will. Solange ihr nicht einen begründeten Verdacht habt, dass euer Kind sich gefährdet, z. B. durch Drogen oder Selbstverletzung, solltet ihr eurem Kind dieses Recht auch zugestehen. Ein Recht aufs Zuschließen gibt es nicht, aber definitiv ein Recht auf Anklopfen (was auch bedeutet, dass ihr draußen bleibt, wenn der Zutritt verneint wird – so lange keine Gefahr besteht).
Hat mein Kind das Recht Freunde nach Hause einzuladen?
Generell sollte das kein Recht sein, dass euer Kind fordern muss, sondern eine Selbstverständlichkeit. Aber natürlich gibt es Situationen in denen Besuch von anderen Kindern nicht angebracht oder machbar ist bzw. die häusliche Situation einfach nicht gegeben ist (Platzmangel, Krankheiten, etc.) Wer ins Haus darf, bestimmen alleine die Eltern, da sie das Hausrecht für ihr Haus oder die Wohnung haben. Wenn euch die Freunde eurer Kinder nicht gefallen, dürft ihr ihnen also den Zutritt zu eurem Zuhause verwehren. Dann treffen sich die Kids aber vermutlich einfach woanders. In solchen Fällen immer lieber das Gespräch mit euren Kindern suchen und versuchen das Problem grundsätzlich zu lösen, statt einfach nur zu verbieten.
Darf ich die Briefe, Emails oder Messenger-Nachrichten meines Kindes lesen?
Nein, dürft ihr nicht. Auch bei der Post greift das gesetzlich verankerte Recht auf Privatsphäre. Die privaten Nachrichten, in welcher Form auch immer, sind für euch tabu – sofern kein begründeter Verdacht auf eine Gefährdung vorliegt. Das gilt natürlich erst ab einem Alter, in dem eure Kinder, die an sie gerichtete Post auch lesen können. Briefe von Ämtern, Versicherungen o. ä. die auch kleine Kinder schon bekommen, dürfen bzw. müssen von den Eltern geöffnet werden. Übrigens dürfen eure Kinder im Gegenzug auch nicht eure Post öffnen!
Wer hat das Bestimmungsrecht über die Schlafenszeit?
Bei kleinen Kindern ist natürlich klar, dass die Eltern entscheiden, wann das Kind ins Bett muss. Aber wie sieht es bei Teenagern aus? Greift hier das Recht auf Selbstbestimmung? Nicht wirklich, denn generell müssen sich die Kinder bis zur Volljährigkeit (bzw. solange sie bei den Eltern wohnen) an die Regeln der Eltern halten. Das schließt die Schlafzeiten ein.
Bei älteren Kindern ist es aber sinnvoll, die Zeiten gemeinsam festzulegen und auch auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder zuzuschneiden – nicht jedes Kind braucht gleich viel Schlaf. Aber auch Eltern haben das Recht auf etwas Ruhe am Abend.
Taschengeld – eine freiwillige oder gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung?
Hier werden viele Kinder enttäuscht sein: Einen gesetzlichen Anspruch auf Taschengeld gibt es nicht. Natürlich ist es aus pädagogischer und zwischenmenschlicher Sicht dennoch eine gute Idee, eurem Kind etwas Taschengeld zu geben oder eine andere Regelung zu finden. Denn damit lernen Kinder den selbstbestimmten und hoffentlich vernünftigen Umgang mit Geld.
Euer Kind bekommt Taschengeld – darf es davon kaufen, was es will?
Paragraphisch mit Artikel § 110 des BGB gesprochen: Ab dem siebten Geburtstag sind Käufe von Kindern wirksam, wenn sie mit Mitteln bewirkt wurden, die ihnen zur freien Verfügung überlassen wurden. Das heißt, dass euer Kind mit seinem Taschengeld (oder anderen Geldgeschenken) grundsätzlich kaufen darf, was es möchte. Allerdings greift der Paragraph nicht bei teuren Anschaffungen, diese fallen laut Auskunft der ARAG Experten im Regelfall nicht unter die Vorschrift des sogenannte "Taschengeldparagraphen". Der entsprechende Vertrag kann daher ohne Genehmigung der Eltern unwirksam sein.
Anschaffungen, die Folgekosten nach sich ziehen, z. B. ein Haustier oder Handyvertrag, sind niemals ohne Genehmigung der Eltern wirksam.
Ab wann dürfen Kinder allein zu Hause bleiben?
Eltern haben ihren Kindern gegenüber eine gesetzliche Aufsichtspflicht. Diese ist aber nicht exakt definiert. Ab einem gewissen Alter ist es den Eltern überlassen, für wie verantwortungsvoll sie ihr Kind halten, um eine Zeit lang alleine zu Hause zu bleiben.
Hat mein Kind das Recht auf Piercings, Tattoos und Haare färben?
Piercings und Tattoos benötigen (zu Recht) die Zustimmung der Eltern. Nach Auskunft der ARAG-Experten dürfen Teenager ab einem Alter von 14 Jahren im Beisein ihrer Eltern gepierct werden. Mit 16 müssen die Eltern nicht mehr dabei sein, allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung abgeben. Ab 18 dürfen eure Kinder mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Auch das Haare färben ist bis zur Volljährigkeit ohne eure Erlaubnis eigentlich verboten. Aber über diesen Punkt lassen die meisten Eltern mit sich reden.
Kann mein Teenagerkind einfach ausziehen?
In der Pubertät geht es zu Hause oft hoch her. Es wird gestritten, Türen geknallt und mit dem Auszug gedroht. Das ist glücklicherweise nur eine Phase und das Ausziehen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Eltern. Denn laut Paragraph § 1631 des BGB umfasst die Personensorge der Eltern das Recht zu bestimmen, wo das Kind wohnt. Macht euer Teenager ernst und sucht sich tatsächlich eine eigene Bleibe (was in der Praxis generell sehr schwer sein dürfte), ist der von dem Jugendlichen abgeschlossener Mietvertrag ohne die Genehmigung der Eltern nicht wirksam.
Kinderpflichten: Was der Staat Kindern zumutet
In unzähligen Varianten von “Muss ich mein Zimmer aufräumen?”, “Muss ich den doofen Blumenkohl essen?”, “Muss ich wirklich mit zum öden Geburtstag von Tante Lotti?” bis hin zu “Warum muss ich schon um 21 Uhr zu Hause sein, Ole darf viel länger raus?” fragen unsere Kinder uns unentwegt, ob sie etwas wirklich müssen. Und klar “müssen” sie das meiste davon, weil es nun mal notwendig ist und vielleicht auch weil wir Eltern es so wollen (weil wir es für richtig halten).
Aber welche Pflichten haben Kinder wirklich laut Gesetz? Haben sie überhaupt welche? Im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB (§ 1619) ist dazu festgehalten: "Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten".
Das klingt ganz schön harsch und oldschool, aber auch nach etwas, das wichtig ist, damit das familiäre Zusammenleben klappt. Gerade zu Zeiten in denen immer öfters beide Elternteile arbeiten gehen, ist es wichtig, dass die Familie gemeinsam an einem Strang zieht und sich gegenseitig unterstützt (das ist natürlich auch wichtig, wenn nur ein Elternteil arbeiten geht oder keines oder es nur ein Elternteil gibt).
Welche Kinderpflichten kann ich meinem Kind zumuten?
Der Paragraph aus dem BGB gibt Eltern kein unbegrenztes Bestimmungsrecht über die Pflichten ihrer Kinder. Das bedeutet aber nicht, dass ihr man seinem Kind alles zumuten darf.
Wie viel und wobei euer Kind zu Hause mithelfen muss, ist natürlich elterliche Ermessenssache. Es gilt aber, dass die Aufgaben immer auf das Alter, die Reife sowie die individuellen körperlichen und geistigen Fähigkeit eures Kindes abgestimmt sein sollten. Außerdem ist Lernen und Spielen definitiv wichtiger als Teller spülen. Es muss bei den auferlegten Kinderpflichten also noch genügend Zeit für Schule und Freizeitaktivitäten bleiben. Und natürlich darf beim Mithelfen der Kinder keine Gefahr für die Kinder entstehen – Zimmer aufräumen top, Fensterputzen im vierten Stock Flop.
Wie viel sollten Kinder in welchem Alter zu Hause mithelfen?
Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, denn es ist auch immer Einstellungssache der Eltern, wie viele Pflichten sie für ihr Kind für angemessen halten. Die einen lassen ihr Kind einfach Kind sein und entbinden es bis zur Teenagerzeit von allen Kinderpflichten, die anderen finden es wichtig, dass ihr Kind so früh wie möglich hilft mit anzupacken. Und in machen Fällen geht es gar nicht anders, als dass die Kinder ihren Teil der Familienarbeit leisten, weil der Alltag sonst gar nicht zu wuppen wäre.
Generell helfen aber gerade Kleinkinder gerne mit. Wenn man die Aufgaben spielerisch verpackt, noch lieber. Und wenn die Kinder von klein auf gewohnt sind, sich einzubringen, fällt es ihnen auch später leichter mitzuhelfen. Kinderpflichten im Haushalt sind aber nicht nur eine Unterstützung für euch, sondern fördern auch die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein eures Kindes. Dabei sollte man seinen Kindern aber auch den Raum lassen, Dinge auch auf ihre Weise zu tun – das übt Problemlösung und eigenständiges Denken.
Quelle: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
Jede*r erzieht anders ... welcher dieser acht Erziehungsstile ist deiner?