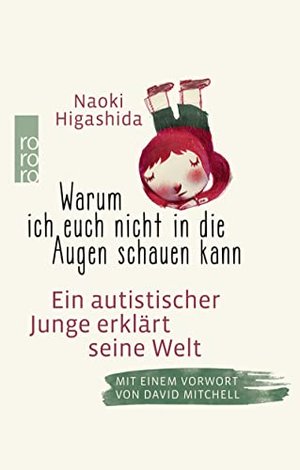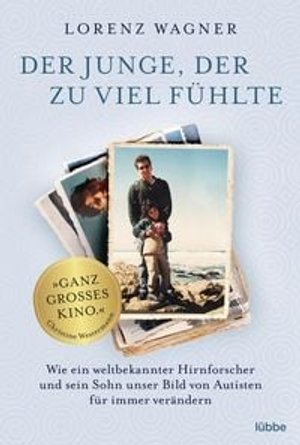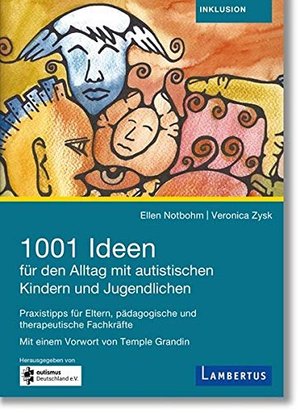Dein Baby wirkt oft ängstlich, in sich gekehrt und schreit viel mehr als andere Babys und das macht dir Sorgen? Das können erste Anzeichen für eine Autismus-Spektrum-Störung im Kleinkindalter sein, aber natürlich auch andere Ursachen haben. Alles, was du jetzt über frühkindlichen Autismus wissen solltest und wie du deinem Kind helfen kannst, erfährst du hier.
Autismus hat viele Ausprägungen, daher sprechen wir heute vom Autismus-Spektrum. Innerhalb des Spektrums gibt es verschiedene Formen, von denen eine der frühkindliche Autismus ist. So bezeichnet wird er offiziell zwar nicht mehr, für Eltern können die Bezeichnungen (wie z. B. auch Asperger-Autismus) dennoch hilfreich sein, um das Feld ein wenig einzugrenzen.
Der frühkindliche Autismus (früher auch Kanner-Syndrom genannt) zählt nach internationalen Diagnosekriterien zu den Entwicklungsstörungen im Baby- und Kleinkindalter. Zu seinen auffälligsten Merkmalen zählen:
- untypische soziale Interaktion, wie z. B. Ablehnung von Körperkontakt
- stereotype und sich stark wiederholende Verhaltensweisen
- verzögerte Sprachentwicklung
Vielleicht ist da manchmal so ein Gefühl
Wenn dein Säugling sich anders als andere Babys in deinem Freundeskreis verhält, ist das erst einmal nichts Schlimmes. Sobald du deswegen aber ein zunehmend mulmiges Gefühl bekommst, solltest du deine Bedenken und Beobachtungen unbedingt bei deinem nächsten Besuch in der Kinderarztpraxis schildern.
Die Kinderärztin ist immer die erste Anlaufstelle, wenn du den Verdacht hast, dass dein Kind im Autismus-Spektrum sein könnte.
Wir recherchieren mit großer Sorgfalt, nutzen vertrauenswürdige Quellen und berichten aus unserem Erfahrungsschatz. Die Ratschläge und Informationen in diesem Artikel ersetzen jedoch keine medizinische Betreuung durch entsprechendes Fachpersonal. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen und Beschwerden an eure Ärztinnen oder psychologisches Personal, damit sie euch individuell weiterhelfen können.
Diagnose Autismus-Spektrum-Störung
Etwa 800.000 Menschen in Deutschland leben aktuell mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Tendenz steigend. Dass immer mehr Menschen diagnostiziert werden, liegt auch daran, dass Eltern heutzutage ganz genau auf ihre Babys und deren Entwicklung schauen und viel früher ihren Arzt fragen, weil Autismus mittlerweile einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist.
Weil Autismus in ganz unterschiedlichen Ausprägungen auftritt – es ist eben ein großes Spektrum – ist es so schwierig, vor dem 6. Lebensjahr eine sichere Diagnose zu bekommen. Frühkindlicher Autismus ist hier eine Ausnahme: Er wird bereits vor dem dritten Lebensjahr diagnostiziert und hat neuesten Forschungsergebnissen zufolge meist erbliche Ursachen.
Symptome von frühkindlichem Autismus beim Baby & Kleinkind
Autismus beim Baby
Folgende Autismus-Symptome können schon bei Babys unter 1 auftreten:
- Stillprobleme, wie z. B. ständige Ablehnung oder Anschreien der Brust
- Schwierigkeiten beim Zufüttern, z. B. starre Vorliebe von Nahrung mit spezieller Konsistenz (fest oder flüssig)
- Sehr unflexibler Schlaf-Wach-Rhythmus
- Kein oder wenig Blickkontakt
- Kein Zeigen von Dingen
- Kein oder wenig Brabbeln, keine Babysprache
- Keine dauerhafte Reaktion auf den eigenen Namen
- Kein Lächeln, wenn das Baby angelächelt wird, kaum freudige Gesichtsausdrücke
- Schaut auf den Zeigefinger des Gegenübers und nicht auf das Gezeigte
- Kein Interesse an anderen Kindern, Dinge sind wichtiger als Menschen
- Abneigung gegen Berührungen und Kuscheln
Autismus beim Kleinkind
Diese Autismus-Symptome treten bei Kleinkindern ab 1 Jahr auf:
- Keine Zwei-Wort-Sätze mit 24 Monaten
- Spielzeug wird anders benutzt – es wird z. B. am Rad eines Spielautos gedreht oder Spielzeug aneinandergereiht oder aufeinandergestapelt
- Echolalie: Wörter einer Frage werden wiederholt, statt eine Ja- oder Nein-Antwort zu geben.
- Große Inflexibilität, wenn es um das Abweichen von Routinen oder sogenannte „Übergänge“ im Alltag geht (Anziehen, Verabredungen, später Schlafen gehen etc.)
Autismus-typische Körperbewegungen, wie z. B. das Flattern mit Händen oder Armen, Kopf wackeln, ständiges hin und her laufen oder hopsen, im Kreis laufen, das Verdrehen von Fingern oder das Schaukeln mit dem Oberkörper sind keine Symptome per se, sondern sogenanntes „Stimming“-Verhalten, das autistischen Kindern dabei hilft, Stress abzubauen und diesen in einen Bewegungsablauf zu überführen.
Bei all den oben genannten typischen Autismus-Symptomen von Babys und Kleinkindern betonten Expert*innen, dass es dennoch schwierig ist, Autismus unter 18 Monaten sicher zu diagnostizieren. Eltern müssen sich in der Diagnostik darauf gefasst machen, viele Fragebögen zum Verhalten ihres Babys auszufüllen. So werden andere Diagnosen oder Erkrankungen ausgeschlossen, bei denen sich ähnliche Symptome zeigen, wie z. B.:
- Auditive Wahrnehmungsstörungen
- Schwerhörigkeit
- Hochsensibilität
- ADS oder Hyperaktivität
- Selektiver Mutismus
Auf der Seite Autismus-Kultur.de kannst du einen ersten Online-Test machen, ob dein Kind eventuell autistisch ist, der allerdings keine professionelle Diagnostik ersetzt.
Wie fühlt sich mein autistisches Kind?
Die autistische Wahrnehmung gleicht einer permanenten Reizüberflutung, die oft dazu führt, dass Kinder sich ins Detail flüchten. Oder eben in einen starren Rahmen, der ihnen das Gefühl von Sicherheit gibt. Alles muss so gemacht werden wie immer. Kommt es zu Abweichungen, führt das zu großem Stress, das Gefühl von Sicherheit schwindet – sei es durch ein neues Gericht, neue Menschen, eine neue Umgebung – alles Neue ist eine große Herausforderung. Wenn etwas nicht wie gewohnt klappt, birgt das ein hohes Frustrationspotenzial. Einige Kinder reagieren dann aggressiv mit Schreien, andere mit Abschottung und Rückzug.
Mir haben diese Bücher sehr dabei geholfen, Autismus ein wenig besser zu verstehen:
Diagnose frühkindlicher Autismus – und jetzt? Hilfe für Eltern
Für Eltern kann es ein frustrierender Prozess sein, bis die Diagnose ASS feststeht – mal abgesehen von der psychischen Belastung durch das herausfordernde Verhalten des Kindes. Je früher man sich diesem Prozedere stellt, desto eher kann die oftmals belastende Familiensituation verbessert werden. Erste Anlaufstellen für Eltern sind:
- Kinderarzt/Kinderärztin
- Schreiambulanzen
- Sozialpädiatrische Zentren (SPZ)
- Kinderneurolog*in
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Autismus-Therapie- und Forschungszentren
Eine weitere Anlaufstelle beim Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung ist Autismus Deutschland e.V. Der Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, der auf sämtliche Regionalverbände und Mitgliedsorganisationen in deiner Nähe weiterleitet.
Wenn du den Austausch mit anderen betroffenen Eltern und Familien suchst, bist du im RehaKids Forum in bester Gesellschaft. Hier kannst du alle Fragen zu Symptomen und Merkmalen des frühkindlichen Autismus stellen, wenn du möchtest, auch anonym.
Was ist Autismus-Therapie?
In einer möglichen Therapie werden Eltern von Kindern unter drei Jahren dann Strategien vermittelt, wie sie ihr Kind im Alltag besser unterstützen können und selbst Entlastung erfahren. Bei Kindern über drei Jahre liegt das Hauptaugenmerk der Autismus-Therapien auf dem Kind selbst, es werden spielerisch Strategien erlernt, damit es besser mit herausfordernden Situationen umgehen und auf Menschen reagieren kann, z. B. mit Bildkarten- oder Wochenplan-Systemen oder Rollenspielen mit der Therapeutin. Auch eine Ergotherapie kann unter Umständen dabei helfen, die Feinmotorik zu schulen und die Selbstwahrnehmung zu stärken.
Auf einen Therapieplatz müssen Familien manchmal lange warten. Hier gibt es Tipps, was Eltern jetzt sofort tun können, um die Familiensituation zu verbessern.
Was verursacht den frühkindlichen Autismus?
Es wird noch immer viel geforscht über die Ursachen von Autismus. Forscher*innen gehen aktuell davon aus, dass ein Großteil der Entwicklungsstörung genetisch bedingt ist. Es gibt aber kein spezifisches Autismus-Gen, sondern eine Vielzahl von genetischen und gesundheitlichen Faktoren, die zu einer ASS führen können. U. a. ist wohl ein höheres Alter der Eltern bei Beginn der Schwangerschaft ein Risikofaktor für eine ASS.
Man weiß, dass Jungen dreimal mehr betroffen sind als Mädchen, was vermutlich daran liegt, dass sich Mädchen im AS „angepasster“ verhalten.
Autismus ist kein Impfschaden!
Klar bewiesen ist heute, dass keinesfalls die Mütter „Schuld“ sind am Autismus ihrer Kinder. Eine amerikanische Studie konnte außerdem belegen, dass weder die Masernimpfungen noch andere Impfstoffe Autismus auslösen. Bitte schaut euch keine YouTube-Videos mit irren Theorien an, die versuchen, euch vom Gegenteil zu überzeugen!
Wichtig zu wissen: Autismus ist keine Krankheit, es ist nicht heilbar. Es ist eine besondere Art, die Welt wahrzunehmen, die Kinder und deren Eltern vor besondere Herausforderungen stellt. Autismus gilt als tiefgreifende Entwicklungsstörung – deshalb steht Familien mit der Diagnose Autismus auch Hilfe und Unterstützung zu. Erkundigt euch bei eurer Krankenkasse.
Hör auf dein Bauchgefühl
Lass dich von anderen Meinungen nicht verunsichern und bleib dran. Als ich ahnte, dass mein Baby im Alltag ständig Angst verspürt, hat unser damaliger Kinderarzt das mit den Worten abgetan „Das verwächst sich noch.“ Obwohl ich ihn mehrmals darauf angesprochen habe und in echt großer Sorge war.
Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, da ist was, dann ist da auch was! Such dir Gesprächspartner*innen, die deine Sorgen ernst nehmen. Für betroffene Familien ist es eine große Herausforderung, nicht allein den Alltag zu gestalten, sondern auch die Diagnose des Kindes anzunehmen. Toleranz und Wohlwollen von Mitmenschen können da einen großen Unterschied machen.
Quellen: Autismus.de, Neurologen und Psychiater im Netz, Autismus Deutschland e.V.