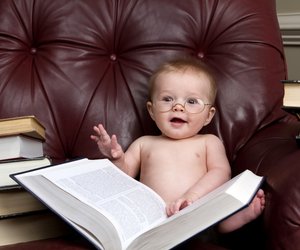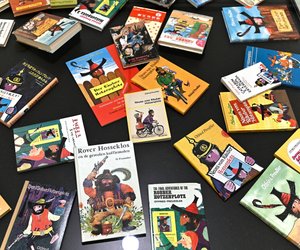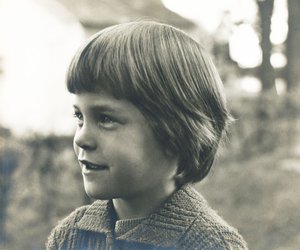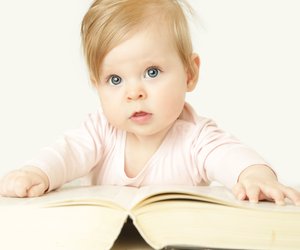Glücklich schwanger
Nomen est Omen!
Beschwerden
Schwangerschaftswochen
Bilderstrecken
Rechtliches & Formalitäten
Vornamen
Geburt
Körperpflege
Schwangerschaftskalender
Ernährung
Umstandsmode
Untersuchungen
Pränataldiagnostik
Schwangerschaft-Tests
Meist Gelesen
ZWEI STRICHE AUF DEM SCHWANGERSCHAFTSTEST...
... und von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr wie es mal war. Schlagartig verschieben sich Prioritäten und die werdenden Eltern finden sich in einer Bubble aus Hoffnungen, Wünschen, Ängsten und jeder Menge Fragen wieder. So einschneidend, neu und einzigartig sich diese Phase für Neu-Eltern auch anfühlen mag – wir bei familie.de kennen das, denn wir sind da alle bereits (mehrfach) durchgegangen. Deshalb findet ihr hier, was wir uns auch für uns gewünscht hätten: verlässliche, unterstützende Informationen für eine gesunde Kugelzeit.
Unser Motto: Kein Druck, kein Stress, no judgement. Dafür jede Menge Empathie, Erfahrungswerte und Empfehlungen, die auf neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Wir begleiten euch durch die 40 (plus minus) spannenden, wilden Schwangerschaftswochen – vom ersten Gedanken ans Familie werden über die Erstausstattung und die Geburtsvorbereitung bis zum Wochenbett findet ihr hier alles wichtige im Überblick.